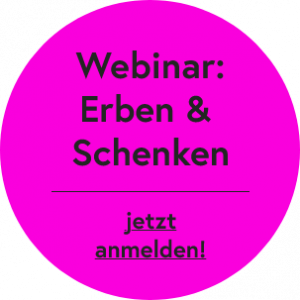Kanzlei für Medizinrecht – unsere Kompetenz ist Ihre Stärke
KWM LAW ist die bundesweite Full-Service Boutique für den Gesundheitsmarkt. Als Kanzlei für Medizinrecht bieten wir umfassende Beratungsleistungen für alle Leistungserbringer. Neben den klassischen Leistungserbringern begleiten und beraten wir ebenfalls Investoren und Start-Ups im Gesundheitswesen. Das umfasst insbesondere Projekte im Bereich Private Equity sowie den Bereich der Digitalisierung.
KWM LAW: Ihre Kanzlei für Medizinrecht
Medizinrechtliche Sachverhalte sind vielfältig – und hoch spezialisiert. Ob Praxiskauf, Zulassung, Abrechnungsstreitigkeit, Haftungsfall, Digitale Gesundheitsleistung oder Eintragung in den Krankenhausplan: Durch die Überlagerung von Rechtsvorschriften müssen in der Regel mehrere rechtliche Ebenen im Blick behalten werden, um Vorhaben rechtssicher und erfolgreich umzusetzen.
Aufgrund des Beratungsschwerpunktes im Medizinrecht setzt sich das Team bei KWM LAW aus erfahrenen Anwälten zusammen, die die jeweiligen Besonderheiten des Rechtsgebietes aus langjähriger praktischer Tätigkeit kennen. Um auch die Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten auf höchstem Niveau abdecken zu können, werden die fünfzehn Fachanwälte für Medizinrecht um weitere Fachanwälte ergänzt. So zählen zu unseren Experten auch jeweils ein Fachanwalt für Familienrecht, eine Fachanwältin für Mietrecht sowie ein Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Unsere Spezialisierung und Erfahrung erlaubt es uns , unsere Mandantinnen und Mandanten bei medizinrechtlichen Problemen die bestmögliche Rechtsberatung und -vertretung zu bieten. Unser Ziel ist es, die Interessen unserer Mandantinnen und Mandaten bestmöglich um- und durchzusetzen.
Durch unsere Spezialisierung sind wir branchenführend.

„KWM LAW berät zuverlässig und lösungsorientiert auf höchstem Niveau zu allen Fragen, von der Regulatorik, über datenschutzrechtliche Fragen bis hin zu strategischen Planungen. Nur zu empfehlen.“
DR. CHRISTIAN KREY (COUNTRY MANAGER DACH BEI DIABELOOP SA)
„Bei meiner komplexen Praxisabgabe hat mich KWM LAW in jeder Hinsicht anwaltlich kompetent begleitet und unterstützt. Dabei hat das Team der Kanzlei stets neben den rechtlichen Eckpunkten auch die wirtschaftliche Ebene und die Verhandlungsführung im Fokus behalten.“
DR. DR. WOLFANG KATER, MKG-CHIRURG UND DYSGNATHIE-EXPERTE
DR. JÜRGEN OHLMEIER
DR. MARION MARSCHALL, FACHREDAKTEURIN
DR. MED. RAMY ZOUBI, MHBA FACHARZT FÜR RADIOLOGIE
FRANZ MAIER, CEO ACURA ZAHNÄRZTE GMBH
GEORG KIRSCHNER, A.S.I. WIRTSCHAFTSBERATUNG AG
KARLHEINZ SCHULER, GESCHÄFTSFÜHRER MVZ GELENK-KLINIK
MICHAEL STEINBACH, TEAM LIEBLINGS-ZAHNARZT GMBH
„KWM ist stets ein wertvoller Partner, wenn es um medizinrechtliche Themen geht. Besonders den unkomplizierten und direkten Kontakt zu den spezialisierten Fachanwälten schätzen wir sehr. Das ist gerade im Segment der digitalen Gesundheit und Telemedizin wichtig, weil dort viele Fragen noch nicht beantwortet sind.“
OLIVER NEUMANN, GESCHÄFTSFÜHRER CYBERCONCEPT GMBH & CYBERDOC GMBH
„Bei meiner Niederlassung und Praxisneugründung wurde ich in allen rechtlichen Fragestellungen – vom Neubau der Praxisräume über das Zulassungsverfahren bis hin zur Prüfung meiner Website – umfassend durch KWM LAW begleitet. Die beteiligten Anwälte haben sich stets kompetent und zielorientiert um alles Erforderliche gekümmert.“
PRIV.-DOZ. DR. MED. MICHAEL BÖHM, FACHARZT FÜR AUGENHEILKUNDE
PROF. DR. DIETRICH GRÖNEMEYER, ARZT UND UNTERNEHMER
„Die Kanzlei berät uns kompetent zu allen Fragen in der komplexen Schnittmenge zwischen klassischem Medizinrecht und immer wieder neu entstehenden Themen, welcher unser Arbeitsfeld, die Digitalisierung der Praxis, betreffen.“
STEFAN MÜHR, GESCHÄFTSFÜHRER ARZDENT GMBH
Ihre Vorteile mit KWM LAW
Durch unsere langjährige Tätigkeit kennen und verstehen wir unsere Mandantinnen und Mandanten. Wir kennen die Branche und wissen, worauf es ankommt. Das hilft uns, Ihre Interessen und Probleme zu verstehen. Unsere Anwälte verfügen über die Erfahrung und das Wissen, um Ihnen weiterhelfen zu können. Unsere Beratung und Vertretung erstreckt sich auf jede Phase einer Transaktion, eines Projekts oder einer Auseinandersetzung. Erfahren Sie mehr über unsere Werte als Kanzlei für Medizinrecht hier.
Kontaktieren Sie uns noch heute zu Ihren medizinrechtlichen Fragen. Egal, ob zu Themen wie MVZ Gründung, ärztliche Kooperationsformen, Praxisübernahme und vieles mehr – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
KWM LAW: Die Vorteile mit uns als Kanzlei für Medizinrecht auf einen Blick
- Über 30 Jahre Erfahrung
- Erfahrenes Anwaltsteam mit Spezialisierung auf Medizinrecht
- Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Zulassung, außergerichtliche Streitigkeiten, Arbeitsrecht, Arzthaftungsrecht und vielem mehr
- Juristische Expertise vereint mit medizinischem Fachwissen
- Engagement für den Schutz der Rechte von Ärzten
- Fähigkeit, erfolgreiche Ergebnisse für alle beteiligten Parteien zu erzielen
- Bestmögliche rechtliche Beratung und Vertretung
- Zugänglichkeit : Wir stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung
- Unterstützendes Umfeld für unsere Mandantinnen und Mandanten während des gesamten Prozesses ihrer Rechtsangelegenheiten
- Wir setzen uns dafür ein, dass Sie Gerechtigkeit und ein faires Ergebnis erhalten